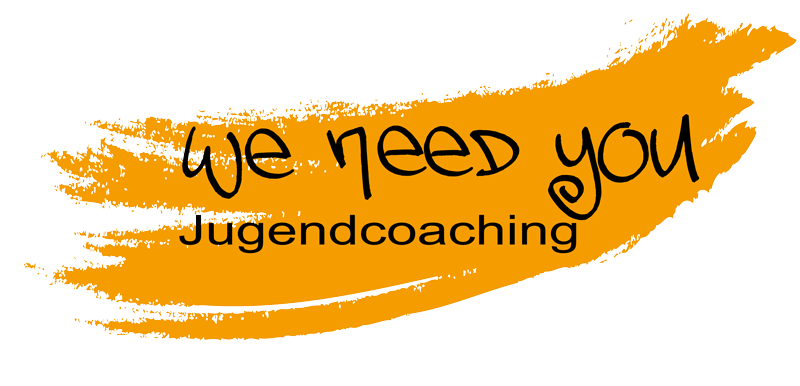Arbeitsfähigkeit bis 25
Fragen & Antworten
Was ist AF25 – und warum gibt es das?
AF25 steht für „Arbeitsfähigkeit bis 25“.
Das bedeutet: Alle jungen Menschen bis 25 Jahre gelten als arbeits- und ausbildungsfähig – ganz egal, ob sie psychische, gesundheitliche oder andere Probleme haben.
Das Ziel von AF25 ist, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zu orientieren, Neues zu lernen, Dinge auszuprobieren und Schritt für Schritt in Richtung Arbeit oder Ausbildung zu gehen.
Was bedeutet AF25 konkret?
- Auch wenn du gesundheitliche, psychische oder andere Schwierigkeiten hast, kann niemand sagen, dass du arbeitsunfähig bist –
- außer du willst das selbst und stellst freiwillig einen Antrag.
- Man bleibt bei AMS angemeldet, bekommt zusätzliche Unterstützung vom Jugendcoaching und anderen Angeboten
Jugendcoaching
Viele Jugendliche kommen ins Jugendcoaching, weil ihnen das von der Schule, vom AMS oder von einer anderen Stelle empfohlen wurde. Manche wissen gar nicht genau, was sie dort erwartet – oder fragen sich, warum sie überhaupt dorthin sollen.
Jugendcoaching ist ein freiwilliges Angebot für junge Menschen, die gerade nicht genau wissen, wie es mit Schule, Ausbildung oder Arbeit weitergehen soll.
Viele junge Menschen haben schon viel erlebt und ausprobiert, bevor sie ins Jugendcoaching kommen – Schule, Projekte, vielleicht auch erste Jobs oder andere Unterstützungsangebote. Das Jugendcoaching hilft dabei, all das gut zu ordnen, zu verstehen, was man kann, was man will – und was als Nächstes möglich ist.
Wenn du Unterstützung brauchst, um deinen nächsten Schritt zu finden – sei es Schule, Ausbildung oder Arbeit – bist du hier richtig. Du bekommst Begleitung, die zu deiner Situation passt – zum Beispiel, wenn du Hilfe bei Bewerbungen brauchst, nicht weißt, welche Möglichkeiten es für dich gibt oder es dir gerade nicht gut geht. Ziel ist, dass du deinen eigenen Weg findest – in deinem Tempo und mit der Begleitung, die du brauchst.
Du bekommst eine:n Coach – das ist eine Person, die für dich da ist und dich unterstützt. Ihr trefft euch regelmäßig und schaut gemeinsam, was dein nächster Schritt sein könnte – und wie du ihn angehen kannst.
Dein:e Jugendcoach:in kennt sich sehr gut aus: mit dem Ausbildungssystem, mit Berufen, dem Arbeitsmarkt und verschiedenen Unterstützungsangeboten. Er/sie hilft dir dabei, den Überblick zu bekommen, Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen – Schritt für Schritt.
Wie das Jugendcoaching genau abläuft, ist unterschiedlich – je nachdem, was du brauchst. Die Gespräche finden meistens im Büro statt, manchmal geht ihr auch gemeinsam zu Projekten oder Bewerbungsgesprächen. Manchmal trefft ihr euch draußen auf einen Spaziergang oder – wenn nötig – bei dir zuhause. Die Treffen sind meist alle zwei Wochen, manchmal öfter oder seltener. Manchmal seid ihr zu zweit, manchmal ist auch jemand aus deiner Familie oder eine andere unterstützende Person dabei.
Im Jugendcoaching arbeitest du mit deiner Jugendcoachin oder deinem Jugendcoach an dem, was dich weiterbringt. Es geht um dich, deine Interessen, deine Ziele – und darum, wie du Schritt für Schritt weiterkommst. Zum Beispiel:
- Potenzialanalyse: Ihr macht Übungen oder kleine Aufgaben, um deine Stärken, Interessen und Fähigkeiten besser kennenzulernen.
- Berufsorientierung: Ihr schaut euch verschiedene Berufe an und überlegt gemeinsam, was gut zu dir passen könnte.
- Projekte kennenlernen: Ihr recherchiert gemeinsam, welche Möglichkeiten es gibt – z. B. Kurse, Ausbildungen oder andere Angebote.
- Schnuppern: Du bekommst Unterstützung dabei, einen Platz zum Schnuppern zu finden – und kannst ausprobieren, ob der Beruf wirklich zu dir passt.
- Bewerbungstraining: Ihr übt gemeinsam, wie man gute Bewerbungen schreibt, einen Lebenslauf erstellt oder sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet.
- Anträge stellen: Wenn es Förderungen oder Unterstützungsangebote gibt, hilft dir dein*e Coach dabei, die passenden Anträge zu stellen.
Wie oft ihr euch trefft und woran ihr arbeitet, hängt ganz davon ab, was für dich gerade wichtig ist.
Wenn du Unterlagen hast – z. B. Lebenslauf, Zeugnisse, Befunde oder etwas vom AMS oder ChG – bring sie mit. Aber keine Sorge: Wenn du nichts von den Sachen hast oder nicht weißt, wo sie sind, ist das überhaupt kein Problem.
Wir finden gemeinsam raus, was gebraucht wird – und wie du drankommst.
- verständnisvoll – du kannst ehrlich sagen, wenn’s mal nicht gut läuft oder dir was zu viel ist
- geduldig – du bekommst Zeit, die du brauchst, und niemand drängt dich
- respektvoll – du wirst ernst genommen, so wie du bist
- ehrlich – du bekommst klare Rückmeldungen, aber auch echte Unterstützung
Du bist nicht allein – gemeinsam finden wir heraus, was für dich passt.
Im Jugendcoaching bekommst du kein Geld direkt.
Aber: Wir helfen dir dabei, herauszufinden, ob du Anspruch auf Geld hast – zum Beispiel auf Familienbeihilfe, erhöhte Familienbeihilfe, Sozialhilfe oder Pflegegeld. Wenn du beim AMS gemeldet bist, kann es auch dort finanzielle Unterstützung geben. Wir schauen gemeinsam, was dir zusteht – und helfen dir, Anträge zu stellen oder die richtigen Stellen zu finden.
Einfach melden – per Anruf, SMS oder E-Mail. Dann machen wir einen Termin aus und schauen, ob und wie wir zusammenarbeiten wollen. Du musst dich zu nichts verpflichten.
Chat-Beratung
Dienstag - Donnerstag 18:00 bis 20:00 Uhr
Chat starten
Coaches
in deiner Region
Telefon
0800 25 22 30
Was kommt nach dem Jugendcoaching?
Je nachdem, wo du gerade stehst, gibt es verschiedene Wege, die du gehen kannst – mit Unterstützung und in deinem Tempo. Manche starten danach eine Ausbildung, andere machen eine berufliche Qualifizierung, ein Praktikum oder suchen eine passende Unterstützung.
Hier findest du einen Überblick über mögliche nächste Schritte nach dem Jugendcoaching:
Wenn du noch keinen Pflichtschulabschluss oder einen negativen Abschluss hast oder beim Lesen, Schreiben oder Rechnen Unterstützung brauchst, kannst du:
- deinen Pflichtschulabschluss nachholen oder ausbessern
- deine Grundbildung in Mathe, Deutsch und Englisch stärken – zum Beispiel, um besser in die Berufswelt einzusteigen
In kleinen Gruppen, mit Unterstützung und in deinem Tempo.
Bekomme ich Geld?
Manchmal ja. Wenn du beim AMS gemeldet bist oder bestimmte Voraussetzungen erfüllst (z. B. Sozialhilfe, erhöhte Familienbeihilfe), bekommst du eine finanzielle Unterstützung während der Ausbildung. Das Jugendcoaching hilft dir, das zu klären.
Wie viele Stunden mache ich das?
Je nach Angebot – meistens 10 bis 30 Stunden pro Woche. Manche Kurse dauern ein paar Monate, andere bis zu einem Jahr.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
- Du kannst den Pflichtschulabschluss nachholen – eine wichtige Voraussetzung für fast alle Ausbildungen und manchen Jobs.
- Du stärkst deine Grundbildung (Deutsch, Mathe, digitale Grundkenntnisse).
- Du bekommst mehr Selbstvertrauen – weil du merkst: Du kannst das schaffen.
Was mache ich dort genau?
- Du lernst in kleinen Gruppen, bekommst Unterstützung von Lehrkräften und Trainer*innen.
- Du wirst auf die Pflichtschulabschluss-Prüfungen vorbereitet.
- Du bekommst Berufswissen, schreibst einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben und bekommst Tipps für deinen weiteren Weg.
Wie bekomme ich einen Platz dort?
Das Jugendcoaching kann dich bei der Anmeldung unterstützen. Es hilft dir, passende Angebote zu finden und dich vorzubereiten.
Es gibt verschiedene Träger in ganz Österreich – zum Beispiel Volkshochschulen, BFI, Caritas oder andere Bildungseinrichtungen.
Wie kann mich das Jugendcoaching dabei unterstützen?
Das Jugendcoaching hilft dir beim Einstieg, bei der Orientierung und beim Dranbleiben. Es ist auch in Kontakt mit den Schulen und Kursen – und kann dich bei Problemen oder Fragen begleiten.
Vorbereitung auf Lehre und Job bedeutet: Du bekommst Zeit und Unterstützung, um dich auf eine Lehre oder Arbeit vorzubereiten – zum Beispiel in der Produktionsschule oder bei AusbildungsFit. Du kannst verschiedene Berufe ausprobieren, Neues lernen und herausfinden, was gut zu dir passt.
Bekomme ich Geld?
Ja. Du bekommst ein Schulungsgeld über das AMS. In manchen Fällen bekommst du zusätzlich Geld über die Sozialhilfe oder Familienbeihilfe. Das Jugendcoaching hilft dir, das zu klären.
Wie viele Stunden mache ich das?
Meistens 20 bis 35 Stunden pro Woche – also wie bei einem Teilzeitjob.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
- Du kannst dich gut auf eine Lehre oder Arbeit vorbereiten.
- Du kannst verschiedene Berufe ausprobieren (z. B. Holz, Metall, Küche, Büro, Handel).
- Du trainierst wichtige Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, Teamarbeit, Bewerbung, Motivation.
- Du arbeitest auch an persönlichen Themen – mit Begleitung.
Was mache ich dort genau?
- Du arbeitest in Werkstätten oder Projekten mit – wie in einem richtigen Betrieb.
- Du bekommst Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen und beim Schnuppern.
- Du redest mit Trainerinnen, Sozialarbeiterinnen und bekommst Hilfe, wenn etwas schwierig ist.
Wie bekomme ich einen Platz dort?
Für manche Projekte wie Ausbildungsfit brauchst du eine Empfehlung vom Jugendcoaching und eine AMS-Meldung, für andere Projekte ist dieses Empfehlung keine Voraussetzung, aber oft ein Vorteil.
Das Jugendcoaching hilft dir bei der Anmeldung, erklärt dir die Angebote und kann auch gleich einen Platz reservieren.
Wie kann mich das Jugendcoaching dabei unterstützen?
Das Jugendcoaching bespricht mit dir, ob AFit oder Produktionsschule zu dir passt.
Es hilft dir bei der Vorbereitung, der Anmeldung und auch bei der Begleitung, wenn du schon gestartet hast.
Es bleibt in Kontakt mit den Betreuer*innen und ist für dich da, wenn du Fragen oder Schwierigkeiten hast.
Berufliche Qualifizierung ist eine Maßnahme, bei der man mit Unterstützung in verschiedenen Arbeitsbereichen praktische Erfahrungen sammelt. Ziel ist, die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und (wieder) fit für den Arbeitsmarkt zu werden – im eigenen Tempo und mit Begleitung. In der beruflichen Qualifizierung arbeitest du praktisch mit – z. B. in einer Tischlerei, Metallwerkstatt, Küche, Gartenbau und vieles mehr.
Bekomme ich Geld?
Ja. Du bekommst ein Schulungsgeld über das AMS. Du bist zusätzlich auch sozialversichert (z. B. Kranken- und Unfallversicherung).
Wie viele Stunden mache ich das?
Meist zwischen 30 und 38 Stunden pro Woche – je nachdem, was für dich gut passt.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
- Du bekommst eine Tagesstruktur und kannst du an einen Arbeitsrhythmus gewöhnen.
- Du kannst dich beruflich orientieren, neue Dinge ausprobieren und üben.
- Du lernst, mit Unterstützung dranzubleiben – das hilft dir später bei Lehre oder Arbeit.
- Du bekommst Rückmeldung zu deinen Fähigkeiten und kannst dich Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Du wirst beim Bewerben und beim nächsten Schritt (z. B. Lehre, Job) unterstützt.
Was mache ich dort genau?
- Du kannst verschiedene Berufe ausprobieren und herausfinden, was zu dir passt.
- Wenn du weißt, welcher Beruf dich interessiert, wirst du gezielt darauf vorbereitet.
- Du lernst Dinge, die du im Berufsleben und im Alltag brauchst.
- Du bekommst Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen und beim Vorbereiten auf Gespräche.
- Es gibt Praktika – entweder in Partnerbetrieben oder direkt bei Firmen am Arbeitsmarkt.
- Du wirst auch persönlich gestärkt: Die Trainerinnen helfen dir, besser mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen.
Wie bekomme ich einen Platz?
- Du brauchst eine Empfehlung des Jugendcoachings.
- Du musst beim AMS gemeldet sein.
- Eine Bedarfsmeldung nach dem ChG ist nötig.
Das Jugendcoaching hilft dir dabei, den richtigen Weg zu gehen.
Wie kann mich das Jugendcoaching dabei unterstützen?
- Es hilft dir herauszufinden, ob eine berufliche Qualifizierung gut für dich passt.
- Es kennt die Angebote in deiner Nähe und hilft dir bei der Auswahl.
- Es unterstützt dich beim Kontakt mit den Anbietern, beim Antrag und bei organisatorischen Fragen.
- Es bleibt an deiner Seite – wenn du das möchtest – und begleitet dich auf deinem Weg.
Du kannst eine reguläre Lehre starten – oder, wenn du mehr Unterstützung brauchst:
- Verlängerte Lehre: Du brauchst länger Zeit, bekommst aber den vollen Lehrabschluss
- Teilqualifizierung: Du lernst nur Teile eines Berufs, mit angepassten Zielen
Bei beiden Formen gibt’s Begleitung – z. B. durch Berufsausbildungsassistenz.
Bekomme ich Geld?
Ja!
- Wenn du eine Lehre im Betrieb machst (regulär, verlängert oder Teilqualifizierung), bekommst du eine Lehrlingsentschädigung vom Betrieb.
- Wenn du eine überbetriebliche Lehre in einer Lehrwerkstatt machst, bekommst du Ausbildungsgeld vom AMS und bist über das AMS kranken- und sozialversichert.
Wie viele Stunden mache ich das?
Du arbeitest und lernst Vollzeit, meistens 38,5 bis 40 Stunden pro Woche.
In der verlängerten Lehre oder Teilqualifizierung kann es individuelle Anpassungen geben, z. B. weniger Stunden oder mehr Pausen.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
Du bekommst eine anerkannte Ausbildung und hast später bessere Chancen auf einen Job.
Wenn eine reguläre Lehre gerade zu viel ist, ist eine verlängerte Lehre oder Teilqualifizierung eine gute Möglichkeit, dich schrittweise ranzutasten – mit mehr Zeit und Unterstützung.
Was mache ich dort genau?
Du arbeitest in einem Lehrbetrieb oder in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung und gehst in die Berufsschule.
Bei der verlängerten Lehre hast du mehr Zeit (z. B. 4 statt 3 Jahre).
Bei der Teilqualifizierung lernst du bestimmte Teile eines Berufs, die gut zu dir passen.
Du bekommst meist auch pädagogische Begleitung und Unterstützung.
Wie bekomme ich einen Platz?
Um einen Platz zu bekommen, musst du ein paar Schritte durchlaufen:
- Bewerbung schreiben
Du brauchst einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben.
Im Motivationsschreiben erklärst du, warum du diesen Beruf lernen möchtest. - Vorstellungsgespräch
Du wirst zu einem Gespräch eingeladen.
Dort erzählst du, was dich interessiert und warum du dich für den Beruf entschieden hast. - Schnuppern
Du schnupperst im Betrieb oder in der Lehrwerkstätte.
So kannst du zeigen, dass du motiviert bist – und sehen, ob der Beruf wirklich zu dir passt. - Entscheidung abwarten
Danach bekommst du Bescheid, ob du den Platz bekommst – entweder im Betrieb oder in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte.
Wie kann mich das Jugendcoaching unterstützen?
Das Jugendcoaching hilft dir:
- herauszufinden, was du gut kannst – also deine Stärken und Talente zu entdecken,
- zu schauen, welche Berufe es gibt – und welche gut zu dir passen könnten,
- zu klären, welche Ausbildungsform zu dir passt – Lehre im Betrieb, Lehrwerkstatt, verlängerte Lehre oder Teilqualifizierung,
- bei der Bewerbung – also beim Schreiben von Lebenslauf und Motivationsschreiben oder beim Üben für das Vorstellungsgespräch,
- und wenn du noch mehr Hilfe brauchst, bringt dich das Jugendcoaching in Kontakt mit anderen Unterstützungsangeboten – zum Beispiel mit der Jugend-Arbeitsassistenz oder einem Bewerbungstraining.
„Arbeit“ bedeutet: Du hast eine Aufgabe in einem Betrieb, für die du bezahlt wirst. Du hast fixe Arbeitszeiten und trägst Verantwortung – zum Beispiel in einer Küche, im Lager, im Verkauf oder im Büro.
„Hilfsarbeit“ heißt: Du brauchst keine abgeschlossene Ausbildung, um den Job zu machen. Du wirst angelernt und kannst sofort mitarbeiten. Auch ohne Schulabschluss oder Lehre kannst du hier Erfahrungen sammeln und Geld verdienen.
Hilfsarbeit ein möglicher Start, um den Einstieg in die Arbeitswelt zu schaffen – und oft ein Sprungbrett für mehr. Manche beginnen so und machen später noch eine Ausbildung.
Bekomme ich Geld?
Ja. Wenn du eine Arbeit hast, bekommst du ein Gehalt vom Unternehmen. Wie viel das ist, hängt von der Branche, dem Kollektivvertrag und deinem Arbeitsumfang (Wochenstunden) ab.
Wie viele Stunden arbeite ich?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt vom Betrieb und von der Stelle ab.
Alles ist möglich: Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise.
Oft sind es zwischen 20 und 38,5 Stunden pro Woche, aber es kann auch weniger oder mehr sein. Hauptsache, es ist für dich schaffbar.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
- Du verdienst dein eigenes Geld.
- Du bekommst erste Arbeitserfahrung.
- Du lernst den Arbeitsalltag kennen.
- Du baust ein Gefühl für Verantwortung und Selbstständigkeit auf.
Was mache ich dort genau?
Das ist ganz unterschiedlich – je nachdem, welchen Job du machst. Du kannst zum Beispiel im Lager arbeiten, Regale einräumen, in der Reinigung helfen, in der Küche mitarbeiten, Büroarbeiten erledigen, am Bau arbeiten und vieles mehr.
Die genauen Aufgaben werden dir am Arbeitsplatz erklärt.
In der Regel gibt es eine Ansprechperson oder Teamleitung, die dir zeigt, was zu tun ist.
Wichtig ist: Du sollst die Aufgaben richtig, verlässlich und in der vorgesehenen Zeit erledigen – möglichst ohne Fehler.
Wie bekomme ich einen Platz?
- Du brauchst einen Lebenslauf.
- Du musst dich bewerben – manchmal auch telefonisch oder direkt vor Ort.
- Es kann ein kurzes Vorstellungsgespräch geben oder ein Probearbeiten.
Wie kann mich das Jugendcoaching unterstützen?
Das Jugendcoaching hilft dir:
- herausfinden, ob Arbeit oder Hilfsarbeit der passende nächste Schritt ist
- erfahren, welche Berufe es gibt und welcher zu dir passt
- Unterstützung im Bewerbungsprozess (z. B. bei Lebenslauf oder Vorstellungsgespräch)
- wenn du weitere Unterstützung brauchst: Weiterverweis an Jugend-Arbeitsassistenz oder andere passende Angebote
Wenn der reguläre Arbeitsmarkt (noch) nicht passt, kannst du in der geschützten Arbeit starten. Geschützte Arbeit ist für Menschen, die anders arbeiten als andere – zum Beispiel langsamer, mit Pausen oder mit Hilfe. Damit auch sie arbeiten können, gibt es Arbeitsplätze mit mehr Begleitung.
Bekomme ich Geld?
Ja. Du bekommst für deine Arbeit ein Entgelt – meistens laut Kollektivvertrag des jeweiligen Betriebs oder Bereichs. Du bist dabei voll sozialversichert (Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung). Wie viel du verdienst, hängt davon ab, wo du arbeitest und wie viele Stunden du arbeitest.
Wie viele Stunden arbeite ich?
In der Regel arbeitest du Vollzeit. Teilzeit ist in manchen Betrieben möglich.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
• Du machst echte Arbeit mit Verantwortung – aber mit mehr Unterstützung.
• Du wirst begleitet und kannst dich beruflich weiterentwickeln.
• Du arbeitest in einem sicheren Rahmen, in dem du zeigen kannst, was du kannst.
Was mache ich dort genau?
Du arbeitest in einem geschützten Betrieb oder in einem Betrieb mit Begleitung (z. B. über ProWork).
Es gibt viele Bereiche – zum Beispiel:
• Küche und Service
• Reinigung
• Lager und Logistik
• Montage, Verpackung oder Metallbearbeitung
• einfache Büroarbeiten
Deine Aufgaben werden dir genau erklärt. Du arbeitest im Team und wirst von Fachkräften begleitet.
Wie bekomme ich einen Platz?
• Zuerst braucht es eine Bedarfsmeldung nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz (ChG).
• Dann wird gemeinsam mit dem/der Bedarfskoordinator*in besprochen, ob geschützte Arbeit für dich passt.
• Danach stellt man einen Antrag.
• Wenn alles passt, bekommst du einen Platz – entweder in einem geschützten Betrieb oder über begleitete Arbeitskräfteüberlassung.
Wie kann mich das Jugendcoaching unterstützen?
• mit dir überlegen, ob Geschützte Arbeit das Richtige für dich ist
• bei der Bedarfsmeldung und beim Antrag helfen
• dich auf die Arbeit vorbereiten – z. B. mit Schnuppern oder Berufsorientierung
• mit dir Ziele überlegen und dich im Übergang begleiten
Was ist das?
Fähigkeitsorientierte Arbeit ist für Menschen, die (noch) nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten oder eine Ausbildung machen können, aber gerne arbeiten möchten – in ihrem eigenen Tempo und mit Unterstützung.
In der Fähigkeitsorientierten Arbeit geht es nicht darum, besonders schnell oder genau zu arbeiten, wie es oft in einem Betrieb oder einer Firma verlangt wird. Stattdessen geht es darum, Tätigkeiten zu machen, die dir Spaß machen und zu deinen Interessen und Fähigkeiten passen.
Bekomme ich Geld?
Du bekommst Taschengeld.
Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, bekommst du z. B. Sozialhilfe, erhöhte Familienbeihilfe oder Pflegegeld.
Auch die Fahrtkosten können übernommen werden.
Wie viele Stunden arbeite ich?
Das ist sehr unterschiedlich – je nach Belastbarkeit und Tätigkeit.
In der Regel zwischen 10 und 25 Stunden pro Woche, verteilt auf mehrere halbe Tage.
Die Stunden werden gemeinsam vereinbart, sodass du nicht überfordert wirst.
Was habe ich davon – welche Vorteile?
- Du hast eine Tagesstruktur und regelmäßige Aufgaben
- Du lernst deine Stärken besser kennen
- Du kannst soziale Kontakte aufbauen und wirst gebraucht
- Du bekommst Unterstützung, um vielleicht später einen anderen Weg zu gehen (z. B. Ausbildung oder Arbeit)
Was mache ich dort genau?
Das hängt von der Einrichtung ab. Typische Bereiche sind:
- Küche oder Kantine
- Gartenarbeit
- Basteln, Handwerk oder kreatives Arbeiten
- Bürohilfe oder Sortierarbeiten
- Unterstützung bei Veranstaltungen oder Botendienste
Meist gibt es eine kleine Gruppe mit fixer Bezugsperson, die dich begleitet.
Wie bekomme ich einen Platz?
- Es braucht eine Bedarfsmeldung
- Danach wird ein Antrag auf Unterstützung nach dem ChG gestellt
- Man muss sich eine passende Tätigkeit oder Einrichtung aussuchen und dort nach freien Plätzen fragen
- Unterstützung dabei bekommst du in der Regel von deiner Bedarfskoordinatorin oder deinem Bedarfskoordinator
Wie kann dich das Jugendcoaching unterstützen?
Das Jugendcoaching ist nicht direkt für die fähigkeitsorientierte Arbeit zuständig.
Aber: Wenn sich im Jugendcoaching zeigt, dass dieser Bereich für dich der passende nächste Schritt sein könnte, bekommst du Unterstützung bei der Antragstellung und Hilfe bei der Suche nach einem passenden Platz.
Beeinträchtigung
Bei bestimmten Ausbildungen und Unterstützungsangeboten fällt manchmal das Wort „Beeinträchtigung“. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn es um finanzielle Hilfe, besondere Ausbildungsplätze oder mehr Unterstützung bei der Arbeit geht.
Mit „Beeinträchtigung“ ist gemeint: Eine gesundheitliche, psychische oder geistige Schwierigkeit, die den Alltag oder das Lernen und Arbeiten beeinflusst. Das kann ganz unterschiedlich sein – zum Beispiel Konzentrationsprobleme, eine körperliche Erkrankung, Schwierigkeiten beim Lernen oder psychische Belastungen.
Viele denken bei dem Wort „Beeinträchtigung“ zuerst an Menschen im Rollstuhl, Blinde oder Gehörlose. Beeinträchtigungen können ganz unterschiedlich sein – und viele sieht man nicht auf den ersten Blick.
Zum Beispiel:
- Starke Ängste oder psychische Belastungen machen den Alltag schwieriger.
- Probleme beim Konzentrieren oder Kommunizieren erschweren das Lernen oder Arbeiten.
- Ein langsameres Lerntempo oder ein anderes Verstehenstempo braucht mehr Zeit oder Unterstützung.
- Chronische Krankheiten führen dazu, dass manche Dinge nicht jeden Tag gleich gut gelingen.
- Vergangene belastende Erfahrungen wirken nach und beeinflussen das Verhalten oder die Leistungsfähigkeit.
- Manche Menschen brauchen klarere Strukturen, mehr Pausen oder einen ruhigeren Rahmen, um gut mitzukommen.
Auch körperliche oder sinnesbezogene Beeinträchtigungen (z. B. Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen) zählen dazu – sie sind oft sichtbarer, aber nicht immer spürbarer als andere.
Eine Beeinträchtigung bedeutet, dass etwas im Leben schwieriger ist – z. B. beim Lernen, in der Schule, im Beruf oder im Alltag. Aber sie bestimmt nicht, wie viel jemand kann oder wie viel möglich ist. Oft entstehen die eigentlichen Schwierigkeiten erst dann, wenn die Umgebung nicht passt – also wenn es zu wenig Unterstützung, falsche Erwartungen oder unpassende Bedingungen gibt. In einer passenden Umgebung, mit den richtigen Hilfen, können Menschen mit Beeinträchtigung ihr Leben gut gestalten, lernen, arbeiten und ihre Stärken zeigen – genau wie alle anderen auch.
- Körperliche Beeinträchtigung: jemand sitzt im Rollstuhl oder kann sich nur eingeschränkt bewegen
- Geistige Beeinträchtigung: jemand braucht länger, um Dinge zu verstehen oder braucht Unterstützung beim Lernen
- Sinnesbeeinträchtigung: jemand ist blind, sehbehindert oder gehörlos
- Psychische Beeinträchtigung: jemand hat zum Beispiel Depressionen, Ängste oder Traumafolgen und ist dadurch im Alltag eingeschränkt
- Autismus, ADHS oder Lernbeeinträchtigungen gehören ebenfalls dazu – oft ohne dass man es sieht
Es gibt viele Menschen mit einer Beeinträchtigung, die durch ihre besonderen Talente, ihren Mut oder ihre Ausdauer Großes erreicht haben. Manche sind weltbekannt – als Musiker*innen, Sportler*innen, Schauspieler*innen oder Aktivist*innen.
Lewis Capaldi – weltbekannter Musiker und Songwriter
- Lebt mit dem Tourette-Syndrom und Angststörungen
- Berührt Millionen Menschen mit seinen Songs und seiner Stimme – z. B. Someone You Loved
- Wurde mit internationalen Musikpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit einem Brit Award
- Spricht offen über psychische Gesundheit – und macht anderen Mut, sich selbst treu zu bleiben
Aaron Fotheringham – Profi-Skater im Rollstuhl
- Er sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl, weil er mit einer Erkrankung geboren wurde.
- Er war der Erste, der einen Salto mit dem Rollstuhl (Backflip) geschafft hat
- Hat eine neue Sportart gegründet: WCMX – Rollstuhltricks auf Rampen, inspiriert von Skateboarding und BMX
- Tritt weltweit bei Shows, Wettbewerben und Events auf – und begeistert sein Publikum mit seinem Mut und seiner Geschicklichkeit
- Sagt selbst: „Ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt – ich nutze ihn wie ein Skateboard“
Nick Vujicic – international bekannter Redner und Autor
- Wurde ohne Arme und Beine geboren
- Hat sehr früh begonnen, vor Menschen über sein Leben mit Beeinträchtigung zu sprechen
- Seine Themen sind: Selbstwert, Hoffnung, Umgang mit Schwierigkeiten und das Vertrauen in sich selbst
- Millionen Menschen folgen ihm in den sozialen Medien – seine Videos wurden weltweit geteilt
- Er hat mehrere Bücher geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden
- Nick zeigt: Auch wenn das Leben schwer beginnt, kann man etwas Großes daraus machen
Billie Eilish – weltbekannte bekannte Musikerin und Sängerin
- Lebt mit Depressionen und dem Tourette-Syndrom
- Wurde mit 14 Jahren durch ihren Song "Ocean Eyes" berühmt
- Hat mehrere Preise gewonnen – als jüngste Künstlerin überhaupt
- Spricht offen über ihre Erkrankung und macht damit vielen Jugendlichen Mut
- Millionen von Fans auf der ganzen Welt fühlen sich durch ihre Songs verstanden
Greta Thunberg - bekannte Klima-Aktivistin
- Hat Autismus und sagt selbst: "Ich sehe die Welt anders - das ist meine Stärke."
- Hat mit 15 Jahren angefangen, für den Klimaschutz zu streiken - jeden Freitag vor dem Parlament in Schweden – und wurde weltweit bekannt
- Aus ihrem Streik wurde eine weltweite Bewegung: Fridays for Future
- Wichtige Politikerinnen und Präsidentinnen laden sie ein und sprechen mit ihr über die Klimakrise
- Sie spricht bei wichtigen Treffen, z.B. bei den Vereinten Nationen
Lionel Messi - einer der besten Fußballer der Welt
- Hatte als Kind eine Wachstumsstörung und musste regelmäßig Hormonspritzen bekommen
- Wurde in der Schule und beim Fußball oft ausgeschlossen, weil er so klein war
- Aber er gab nicht auf: Er trainierte hart, glaubte an sich - und zeigte, was in ihm steckt
- Heute ist er mehrfacher Weltfußballer, hat Weltmeistertitel gewonnen und Millionen Fans
- Viele feiern ihn als größten Fußballer aller Zeiten
Diese Persönlichkeiten zeigen:
Wer sich auf seine Stärken und Talente fokussiert, kann viel erreichen – auch wenn der Weg nicht immer einfach ist.
Ob in Musik, Sport, Wissenschaft oder Gesellschaft – viele Menschen mit Beeinträchtigung haben neue Perspektiven eröffnet und wichtige Beiträge geleistet.
Nicht, weil alles sofort geklappt hat – sondern weil sie dran geblieben sind. Weil sie ihre Möglichkeiten genutzt, Unterstützung angenommen und eigene Wege gefunden haben. Oft sind es gerade die Herausforderungen, die besondere Fähigkeiten sichtbar machen:
Klarheit, Ausdauer, Kreativität, ein eigener Blick auf die Welt.
Chancengleichheitsgesetz
Das ChG sorgt dafür, dass alle Menschen gut leben können – auch wenn sie eine Beeinträchtigung haben.
Das heißt:
• Alle sollen mitmachen können – in der Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit.
• Alle sollen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
• Alle sollen gleich behandelt werden – mit Respekt und ohne Ausgrenzung.
Wenn du z. B. eine geistige oder körperliche Erkrankung oder Beeinträchtigung hast und dadurch im Alltag, in der Ausbildung oder im Beruf eingeschränkt bist, kannst du Unterstützung nach dem ChG beantragen.
Das bedeutet:
- Du kannst individuelle Unterstützung bekommen, zum Beispiel durch persönliche Assistenz, Arbeitsassistenz, Wohnbegleitung oder Freizeitassistenz.
- Es kann auch Unterstützung für deine Familie geben – zum Beispiel Beratung oder Begleitung.
- Wenn du in einer Ausbildung bist oder eine machen möchtest, kann man schauen, welche Hilfen du brauchst, damit du gut mitkommst.
Du musst nicht alles allein herausfinden. Es gibt Leute, die dir helfen – zum Beispiel:
- Deine Jugendcoachin / dein Jugendcoach
- Deine Bedarfskoordinatorin / dein Bedarfskoordinator
- Deine AMS-Beraterin / dein AMS-Berater
- Eine Sozialarbeiterin oder Behindertenvertretung (ÖZIV)
Gemeinsam schaut ihr, ob du Anspruch auf Leistungen nach dem ChG hast und welche Schritte nötig sind. Manchmal braucht es dafür einen Antrag oder ein Gutachten – dabei wirst du unterstützt.
Wichtig:
Niemand wird gezwungen, so eine Unterstützung zu beantragen. Aber wenn du Hilfe brauchst, kann das ChG eine große Chance sein, damit du deinen Weg gehen kannst – mit der Unterstützung, die für dich passt.
Die Bedarfs-Koordinatorin oder der Bedarfs-Koordinator ist deine erste Ansprechperson.
Du findest sie oder ihn bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) oder beim Magistrat.
Wenn du Unterstützung nach dem Chancengleichheitsgesetz (ChG) bekommen möchtest, gibt es zwei Schritt
- Zuerst wird eine Bedarfsmeldung gemacht. Dabei wird festgehalten, dass du Unterstützung brauchst – und in welchem Bereich.Dann stellst du einen Antrag.
- Das ist das offizielle Formular, mit dem du um Unterstützung ansuchst.
Nach dem Antrag bekommst du einen Bescheid.
Der Bescheid sagt dir:
- Ob du Unterstützung bekommst oder nicht
- Welche Unterstützung du bekommst
Je nach Bedarf können zum Beispiel folgende Leistungen möglich sein:
- Begleitung im Alltag (z. B. durch eine Persönliche Assistenz)
- Unterstützung beim Wohnen (z. B. betreutes oder teilbetreutes Wohnen)
- Fähigkeitsorientierte Arbeit, Berufliche Qualifizierung oder geschützte Arbeit
- Unterstützung bei der Arbeit (z. B. Arbeitsassistenz)
- Freizeitassistenz (z. B. Begleitung bei Hobbys oder Ausflügen)
- Beratung und Hilfe für Angehörige
- Mobile Betreuung (Hilfe im Alltag, im Haushalt, mit Terminen)
Welche Leistung du bekommst, hängt von deiner persönlichen Situation ab.
Das wird gemeinsam in der Assistenz-Konferenz besprochen.